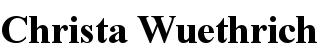«Im Paradies»
Jules dachte er sei im Paradies. Dann wurden in 100 Tagen über 800’000 Menschen umgebracht – die meisten in beschwerlicher Handarbeit von ihren Nachbarn mit Macheten zerlegt. Was ist in Ruanda falsch gelaufen und warum ist Jules immer noch da?
«Den ganzen Tag in der Natur arbeiten, auf einem Hügel im halbhohen Gras unter einer Bananenstaude im Schatten sitzen, ins Tal hinunterschauen und die Schwalben beobachten. Kupfernes Sonnenlicht, rostrote Erde und ein so unwirklich intensives Grün, dass man zu träumen glaubt. Weit weg das Lachen von spielenden Kindern, die tiefe Stimme vom Hirten der seine Kühe zusammentreibt – und sonst nichts. Der Inbegriff von Ruhe und Frieden. Ein Gefühl, als sei ich dem Himmel ein wenig näher – gelandet im Paradies».
Jules, der im realen Leben anders heisst, kommt in den 40er Jahren als Sohn einer Unternehmerfamilie in einer europäischen Kleinstadt zur Welt. Er macht nie ein Geheimnis daraus, dass ihn eine gutbürgerliche Karriere nicht interessiert. Seine Welt ist der Wald. Das Jurastudium bricht er nach zwei Monaten ab. Die Bücher verkauft er. Das Geld braucht er für Köder, um tagsüber zu fischen und für Alkohol, um die Nächte durchzufeiern. Bei der Aufnahmeprüfung für die Forstschule scheitert er wiederholt. Der Direktor ist jedoch fasziniert vom jungen Mann und dessen Begeisterung für die Natur und gibt ihm eine Chance. Jules nutzt sie, wird zum Forstexperten, bildet sich weiter, reist viel und erhält einen guten Job in einem Büro mit Blick auf eine graue Betonwand. Nach dem ersten Arbeitstag packt er seine Sachen, sucht das Weite und nimmt eine Stelle in der Entwicklungszusammenarbeit an: Im Herzen Afrikas. Genauer gesagt auf einem Hügel in einer abgelegenen Provinz in Ruanda, wo es weder Strassen, fliessend Wasser noch Strom gibt. Sein Vorgänger hielt es gerade mal zwei Monate aus.
Kolonialisten, Kaffee und Konflikte
Es ist Mitte 80er Jahre. Ruanda, ein landwirtschaftlicher Kleinstaat, der gerade mal halb so gross wie die Schweiz ist, exportiert als Hauptprodukt Kaffee und wird von drei Bevölkerungsgruppen besiedelt: Den Hutu, die etwa 85 Prozent der rund 6 Millionen Einwohner stellen, der Minderheiten der Tutsi mit 14 Prozent und der Twa mit knapp einem Prozent. Alle Gruppen sprechen mit “Kinyarwanda” die gleiche Sprache und teilen die gleiche Kultur. Der Unterschied der beiden Hauptgruppen liegt ursprünglich in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Stellung. Die Minderheit der Tutsi widmen sich der Viehzucht. Rinder sind ein Zeichen von Reichtum und Status. Die Hutu kümmern sich um den Ackerbau. Ein durchlässiges, tolerantes System, bis die Kolonialmächte Deutschland (1884-1916) und Belgien (bis 1962) die grossgewachsenen und schlanken Tutsi als höherwertige Rasse identifizieren, bevorzugen und fördern. Es wird eine Tutsi-Monarchie eingesetzt und die Hutu werden von Bildung und Arbeit im öffentlichen Dienst ausgeschlossen. Mit Einführung der Ethnien der Hutu und Tutsi und deren Vermerk im Personalausweis, wird eine rassistische, unüberbrückbare Rangordnung zementiert.
Jules lebt das gleiche einfache Leben wie die Einheimischen – mit dem Unterschied, dass er ein Motorrad und ein mit Petroleum angetriebenen Kühlschrank besitzt – und dass seine Haut genau so weiss ist, wie die der Kolonialisten.
Ausgebeutet und von Macht und Privilegien ausgeschlossen, wächst unter den Hutu ein enormer Hass. 1959 kommt es bei Aufständen zu Hunderten von Toten. Die Belgier schlagen den Aufstand nieder. 1961 wird bei der ersten Abstimmung in der Geschichte Ruandas die Monarchie abgeschafft und die Hutus übernehmen die Macht. 1962 wird Ruanda unabhängig. Die kommenden Jahre sind von Massakern und Gewalttaten zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen geprägt. An der Macht bleiben die Hutu, Tausende von Tutsis fliehen in die Nachbarländer. Eine einzige Hutu-Partei – durch die Geburt wird jeder Ruander automatisch Mitglied – ist im Land zugelassen und schafft ein System der absoluten Kontrolle.
Doch Jules ist vorbereitet. Er kennt die Geschichte Ruandas, weiss von den Spannungen und Massakern. Spüren tut er davon nichts. Er arbeitet mit Hutu und Tutsi zusammen. Gemeinsam teilen sie sich nach Feierabend eine Flasche Bier und essen Ziegenfleisch-Spiesse. Am Wochenende kauft er sich auf dem lokalen Markt den Reis, die Kochbananen und Süsskartoffeln für die gesamte Woche, das Fleisch direkt vom Schlachter. Er lernt Kinyarwanda, schliesst Freundschaften, ist an Hochzeiten eingeladen, wo ausgelassen getanzt und gesungen wird und sieht wie seine Freunde Kinder bekommen und sie Dieudonne (Gott gibt), Innocent (Unschuld) oder Esperance (Hoffnung) nennen. Jules lebt das gleiche einfache Leben wie die Einheimischen mit dem Unterschied, dass er ein Motorrad und ein mit Petroleum angetriebenen Kühlschrank besitzt – und dass seine Haut genau so weiss ist, wie die der Kolonialisten. Doch im Gegensatz zu ihnen beschliesst er für immer zu bleiben, verliebt sich, heiratet, zieht in ein anderes Dorf und gründet eine Familie. Der Bürgermeister wird stolzer Patenonkel.
Unterdessen schlittert Ruanda in eine wirtschaftliche Krise. Der Exportpreis für Kaffee kollabiert, der ruandische Franken verliert fast 70 Prozent an Wert. Das Regime verstaatlicht Land und baut Teeplantagen an, jedoch ohne grosse wirtschaftliche Wirkung. Die Bevölkerung wächst weiter sprunghaft an und das Land wird für die mehr als sieben Millionen Einwohner knapp. Die Kombination aus Landmangel, Bevölkerungsexplosion und wirtschaftlicher Krise führt schlussendlich zur totalen Verarmung. Die Bevölkerung ist unzufrieden und fordert Demokratie und Mitbestimmung. Forderungen kommen auch aus dem benachbarten Uganda. Hier haben sich seit 1987 Exil-Tutsi zur Ruandischen Patriotischen Front (RPF) formiert. Ihr Ziel ist es wieder nach Ruanda zurückzukehren, doch die Regierung blockt jegliche Versuche ab. Am 1. Oktober 1990 startet die RPF von Uganda aus einen Guerillakrieg. Das Regimen Ruanda fühlt sich von innen und aussen akut bedroht, gibt die Schuld für die Misere den Tutsi und startet mit einer politischen Hetzkampagne.
Gerüchte, Geschichten und Gemetzel
«Das staatliche Radio berichtete über die Angriffe der RPF, doch für uns schienen die Geschehnisse zu einer anderen Welt zu gehören. Die Dorfbewohner nahmen es zur Kenntnis und gingen scheinbar unbeeindruckt wieder ihrer Arbeit nach», erinnert sich Jules. Ruanda ist ein Land der Geschichten und Gerüchte, des «Sich-Erzählens» und «Dazu-Fügens». Neuigkeiten haben einen langen Weg hinter sich, bis sie in der Provinz ankommen. Sie werden wie Fremde behandelt; mit Distanz ruhig und neugierig beobachtet. Als es in der Nacht zum 4. Oktober 1990 in der Hauptstadt Kigali zum scheinbaren Schlagabtausch zwischen Tutsi Rebellen und der Armee des Regimes kommt, schlafen Jules und seine Familie friedlich, tief und fest. Niemand denkt auch nur im Traum daran, dass es in Kigali gar keinen Angriff der Tutsi-Rebellen gab, sondern der ganze Vorfall vom Hutu-Regime inszeniert wurde, um einen Vorwand zu schaffen, um Tausende von Tutsi zu verhaftet, einzusperren oder zu beseitigen. Tage nach der «Nacht von Kigali» besucht Jules Chef die Familie. «Er war mit dem Motorrad aus Kigali angereist. Eine stundenlange und beschwerliche Reise auf staubigen Strassen übersät mit Schlaglöchern, getrieben von der Angst, dass wir alle nicht überlebt haben», erinnert sich Jules. Denn er, der Weisse verheiratet mit einer Tutsi, wäre ein gefundenes Fressen für die Hutu-Extremisten. Jules Chef nimmt die fast gespenstische Ruhe und Trägheit der Leute im Dorf nur ungläubig zur Kenntnis, händigt die mitgebrachten Sardinen und Tafelschokoladen aus und macht sich – erstaunt, aber keinesfalls beruhigt – auf den Rückweg.
Klar gab es diese Kommentare: Als ein Tutsi Mädchen im Dorf einen Hutu-Jungen heiratete, hiess es: Jetzt hat das hilflose Rebhuhn endlich einen Busch gefunden, um sich zu verstecken.
In den kommenden drei Jahren gibt es immer wieder gewalttätige Ausschreitungen und Massaker. Das Land zu verlassen, ist für Jules keine Option. «Warum auch? Das war unser Zuhause, wir fühlten uns sicher, hatten kleine Kinder und eine grosse Verwandtschaft, für die wir uns verantwortlich fühlten. Klar gab es diese Kommentare – schon vor 1990 und den Unruhen – die mich zweifeln liessen. Als ein Tutsi Mädchen im Dorf einen Hutu-Jungen heiratete, hiess es: Jetzt hat das hilflose Rebhuhn endlich einen Busch gefunden, um sich zu verstecken. Oder wenn wir Bananenstauden schnitten, wurde dies von gewissen Mitarbeitern mit einer unglaublichen Innbrunst und Effizienz getan, genauso «wie wir es mit den Bananenstauden der Tutsi gemacht haben». Ich taxierte die Kommentare als einzelne, dumme Sprüche.»
Der Konflikt zwischen dem Hutu-Regime und der RPF dauert an. Im August 1993 einigen sich die Parteien auf einen Friedensvertrag. Eine Übergangsregierung, unterstützt vor Ort durch UN-Truppen, soll ein Mehrparteiensystems einführen und die politische Opposition integrieren. Ruandas Hutu-Regime willigt nur widerwillig unter internationalem Druck ein. Gescheiterte Verhandlungen hätten den Verlust der finanziellen Unterstützung durch den Westen bedeutet. Der Friedensvertrag und die unterbesetzten UN-Truppen – die über kein Mandat für ein militärisches Eingreifen verfügen – werden von den radikalen Hutus nicht akzeptiert. Sie starten mit der Vorbereitung zum Völkermord. Es werden radikale Kampftruppen rekrutiert und ausgebildet, Waffen beschafft und Todeslisten mit Namen von Tutsis und gemässigten Hutus erstellt. Die Milizen propagieren durch Fehlinformationen und Verleumdungen die Beseitigung der Tutsi. Strafbar macht sich, wer sie nicht denunziert.
Keine Menschen, sondern Kakerlaken und Ungeziefer: Eine Plage, die es ohne Zögern und schlechtes Gewissen zu eliminieren gilt.
Als Propaganda-Instrument dient der Radiosender „Radio Télévision Libre des Milles Collines“. Es ist für die Menschen in Ruanda, von denen 40 Prozent weder lesen noch schreiben können, neben dem staatlichen Radio der einzige Informationskanal. Der Sender bezeichnet die Tutsi als Kakerlaken und Ungeziefer. Keine Menschen – sondern eine Plage, die es ohne Zögern und schlechtes Gewissen zu eliminieren gilt. „Milles Collines“ operiert in der Landessprache „Kinyarwanda“. Ein belgischer Journalist übersetzt die Hetztiraden ins Französische. Jeden Morgen um acht Uhr versammeln sich nun Jules Mitarbeiter und die Gemeindeangestellten im Projektbüro um ein kleines, graues Transistorradio und hören aufmerksam «Milles Collines». Der Sender bietet als Unterhaltung getarnte Gerüchte, Geschichten und Witze, die auf die Tutsi zielen und die UN-Truppen und die Politiker der Opposition verurteilen. «Die Sendungen fanden mit jedem Tag mehr Gehör. Es war vergleichbar mit einer Infusion, die man einem Kranken gibt – und täglich ein wenig die Dosis erhöht. Hier handelte es sich nur nicht um ein Medikament, sondern um puren Hass. Mit der Zeit waren die Menschen davon überzeugt, dass ihre Tutsi-Nachbarn Spione der feindlichen Rebellen waren und damit eine konstante Bedrohung, die es zu beseitigen galt,» erinnert sich Jules.
Einige, der um das alte Radio versammelten Mitarbeiter sind Tutsi. Auch sie hören jeden Morgen den Verleumdungen aufmerksam zu und lachen genau so laut wie ihre Hutu-Kollegen ab den niederträchtigen Witzen. Die Angst auf- oder abzufallen und dann denunziert zu werden, lässt keine Kritik, kein Aufbegehren zu. Mitlachen als Überlebensstrategie. Einer von Jules Mitarbeitern trägt nun immer eine Axt am Gurt. Wenn er nach Feierabend zu viel trinkt, droht er ein paar Tutsi umzubringen.
Milizen, Massaker und Mitfahrer
Am Abend des 6. April 1994 wird das Flugzeug mit Hutu-Präsident Juvénal Habyarimana an Bord im Landeanflug auf Kigali abgeschossen. Jules sitzt beim Abendessen mit seiner Familie, als «Milles Collines» die Meldung vom Flugzeugabschuss verbreitet. Jules ist in Panik, sitzt bis spät in der Nacht vor dem Radio. Doch Neuigkeiten bleiben aus. Der Sender spielt ununterbrochen klassische Trauermusik. Um 6 Uhr bestätigt das staatliche Radio den Absturz und den Tod des Präsidenten. «Ich war gelähmt vor Angst. Doch das war die falsche Reaktion. Ich sagte Else, meiner Frau, dass wir was tun müssen. Untätig herumsitzen macht nur mehr Angst. Wir begannen das Geschirr abzuwaschen und aufzuräumen, nur um nicht tatenlos zu sein», erinnert sich Jules. Doch das beklemmende Gefühl bleibt. Jules eilt zum Gemeindehaus, wo er auf Mitarbeiter, Bekannte und Vertraute des Bürgermeisters trifft. Es wird in kleinen Gruppen leise diskutiert. Jules wird gemieden, seinem Blick ausgewichen. Er holt schweigend einige Papiere aus seinem Büro und geht nach Hause.
In einer Wagenkolonne mit improvisierten weissen Flaggen rollt ein letzter Konvoi mit Weissen Richtung Grenze. Ausländer, kreidebleich vor Angst, die sogar ihre Hunde retten, dafür ihre Hausangestellten zurücklassen.
«Milles Collines» koordiniert von Kigali aus, die Jagd auf die Tutsi, verbreitet Informationen zu ihren Aufenthaltsorten und Fluchtstrategien. In Kigali stapeln sich die Leichen. Andere Dörfer kommen laufend hinzu. Bei Jules in der Provinz schwindet der letzte Funke Hoffnung, dass sich die Gewalt, wie in den vergangenen Jahren, temporär auf einzelne Gegenden beschränkt. Die Massaker breiten sich aus wie ein Flächenbrand – in Windeseile und ausser Kontrolle. Jules bespricht sich mit seiner Familie und einem ausländischen Freund. Danach packt er Frau und Kinder, Kleider und ein paar Negativabzüge von Fotos in seinen alten kleinen Peugeot. Mehr Platz hat es nicht. «Als wir unser Zuhause verliessen, stand unser Nachbar, ein schlanker, alter Tutsi, alleine vor seinem Haus. Als hoher Funktionär war er ein einflussreicher und angesehener Mann. Ich war erstaunt ihn noch im Dorf zusehen und hielt an. Ich fragte ihn, warum er noch nicht geflüchtet sei. «Vielleicht wäre es besser,» kommentierte er ruhig und emotionslos». Als Jules mit seinem Peugeot am grössten Hotel und Restaurant in der Gegend vorbeifährt, sieht er wie alle Tische und Stühle auf der Terrasse ins Innere geräumt werden, so wie vor einem grossen Sturm. In einer Wagenkolonne mit improvisierten weissen Flaggen rollt ein letzter Konvoi mit Weissen Richtung Grenze. Ausländer, kreidebleich vor Angst, die sogar ihre Hunde retten, dafür ihre Hausangestellten zurücklassen.
«Von Elses Eltern hatten wir immer noch kein Lebenszeichen. Ihr Bruder Eduard lebte jedoch bei uns. Wir packten ihn mit ins Auto, obwohl er keinen Pass besass. Ich parkierte bei der Grenzkontrolle ausser Blickweite der Zöllner. In der Warteschlange fragte ich die anderen flüchtenden Ausländer, was sie tun würden an meiner Stelle. Eduard zurücklassen und den Hutu-Milizen überlassen oder mitnehmen und die ganze Familie in Gefahr bringen? Ich schlug ihre Ratschläge in den Wind, zeigte die Pässe, liess sie mir abstempeln und fuhr im Schritttempo langsam über die Grenze am Zöllner vorbei – ohne zu stoppen, ohne einen Blick zurück. Else neben mir auf dem Beifahrersitz, Eduard dahinter zwischen den Kindern. Einige Tage nachdem wir das Land verlassen hatten, begannen die Hutu-Milizen auch in unserem Dorf mit dem Massaker.»
Jules und seine Familie werden zurück in ihr Heimatland geflogen. Eduard darf nach langen Verhandlungen mit. Er bekommt ein Einreisevisa und einen ruandischen Pass. «Ein Pass? Sinnlos. Euch wird es schon bald nicht mehr geben», kommentierte der ruandische Beamte, der ihm auf der Botschaft den Ausweis aushändigt grinsend. Doch er und seine Milizen-Freunde irren sich. Nach 100 Tagen und rund 800’000 Toten übernimmt im Juli 1994 die Tutsi-Rebellenarmee die Macht, beendet den Völkermord und löst eine Fluchtwelle unter der Hutu-Bevölkerung aus. Ende 1994 sind laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem UNHCR zwei Millionen Menschen aus dem Land geflohen, 1,5 Millionen wurden innerhalb des Landes deplatziert.
In den ehemaligen Kinderzimmern und der Stube wächst kniehohes Gras, Wasserpfützen und Dreck bedecken die Böden – und es fehlen überall die Menschen, die bekannten Gesichter. Nachbarn gibt es keine mehr.
«Wir wussten nicht, ob die Eltern und Geschwister von Else überlebt haben. Eine Ungewissheit, die zermürbt, einen Stück für Stück auffrisst», erinnert sich Jules. Im Oktober 1994 reisen Else und Jules nach Ruanda. Der Geruch von Leichen ist überall. Viele der Toten wurden in ihren eigenen Toiletten oder Jauchegruben entsorgt – und liegen immer noch dort. Das ehemalige Zuhause von Jules ist geplündert. Es fehlt das Dach, die Türen und alles was auch nur scheinbar wertvoll erschien – die Stühle, der Tisch, die Kochtöpfe. In den ehemaligen Kinderzimmern und der Stube wächst kniehohes Gras, Wasserpfützen und Dreck bedecken die Böden. Im verlassenen Haus eines geflüchteten Hutu-Nachbars findet Jules eine Liste mit Namen und Anweisungen, wie nach der totalen Auslöschung der Tutsi deren Hab und Gut unter den Hutu verteilt wird. Ein feinsäuberlich erstellter Plan, genauso wie es die Bauern in Jules Landwirtschaftsprojekt gelernt haben. Das Dorf ist wie ausgestorben. Es fehlen die Menschen, die bekannten Gesichter. Die einen wurden umgebracht, die anderen sind auf der Flucht. Die wenigen, die überlebt haben, kämpfen mit ihren Erinnerungen, so auch Elses Familie.
Grauen, Gerechtigkeit und Gnade?
Jules erfährt, dass sich im kleinen Dorf von Elses Familie, sich die Bewohner weigerten, sich gegenseitig zu töten. Anfangs zog die lokale Hutu-Miliz noch unverrichteter Dinge wieder ab. Zwei Wochen später erschienen sie wieder im Dorf und stellten die Menschen vor die Wahl. Wer sich als Hutu weigert zu töten, wird vor Ort und Stelle massakriert. Zusammen als Familie zu flüchten, schmälert die Chance zu überleben. Die Mutter von Else versteckt sich alleine im Wald und später in einer Kirche. Der Vater findet Unterschlupf im Dorf und flüchtet dann in die Wälder. Warum er überlebt, ist für ihn bis heute ein Rätsel, rational nicht erklärbar. Der jüngere Bruder von Else, Vater von zwei kleinen Jungen, sucht vergebens nach seinem jüngsten Sohn. Ohne ihn weigert er sich das Dorf zu verlassen. Er wird zusammen mit dem älteren Jungen von den Hutu-Milizen mit Macheten niedergestreckt. Der kleine Sohn überlebt den Genozid. Hutu-Freunde der Familie verstecken ihn. Drei weitere Geschwister suchen Schutz in den Sümpfen und Wäldern. Sie verkriechen sich unter Kadavern und beten am nächsten Morgen immer noch zur untersten Schicht der Lebenden zu gehören. Sie verhalten sich wie Tiere, ernähren sich von Wurzeln und Insekten und überleben nur, weil sie sich während Tagen totstellen oder von den Milizen ausversehen nur bewusstlos und nicht totgeschlagen werden.
«Du siehst die Überlebenden, hörst ihre Geschichten und kannst immer noch nicht verstehen, wie das passieren konnte», sagt Jules konsterniert. Der Patenonkel von einem der Kinder entpuppte sich als Drahtzieher bei den Tötungen und musste sich vor Gericht verantworten, andere Hutu-Bekannte flohen ins Ausland oder endeten im Gefängnis. Der Nachbar, der angesehene Funktionär, wurde zusammen mit seiner gesamten Familie getötet. Der belgische Radiojournalist, der die Hetztiraden auf Französisch übersetzte, wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.
Jules erinnert sich: «Einer meiner französischen Kollegen, hatte sich geweigert das Land zu verlassen. Er besass eine grosse Autogarage in der Hauptstadt. Das Geschäft war sein Leben. Frau und Kinder flogen zurück nach Frankreich. Er setzte auf eine kugelsichere Weste und seine einheimischen Mitarbeiter. Monate nach dem Genozid musste ich ihn vor Ort identifizieren, als ein Grab mit Opfern ausgehoben wurde. Überlebende berichteten, dass er bei einer Strassensperre angehalten, abgeführt und erschossen wurde. Die Weste zog er sich vorher eigenhändig aus.»
Täter und Opfer werden wieder zu Nachbarn – als lägen dazwischen nicht dutzende von Toten, sondern nur ein paar Bananenstauden und ein kleines Stück Land.
Die Familie von Else kehrt Wochen nach dem Genozid wieder in ihre Häuser auf dem abgelegenen Hügel zurück und beginnt das gleiche Leben wie zuvor. Mit der Zeit kommen auch die Täter zurück. Ein nach dem Genozid eingeführtes Justizsystem – basierend auf lokalen Dorfgerichten – macht es möglich, dass sie früher entlassen oder gar begnadigt werden. Täter und Opfer sind wieder Nachbarn – als lägen dazwischen nicht dutzende von Toten, sondern nur ein paar Bananenstauden und ein kleines Stück Land. Sie teilen sich das Feierabendbier, feiern zusammen Feste, trauern gemeinsam, wenn jemand stirbt und nennen ihre Kinder immer noch Dieudonne und Innocent. Das Leben hat sie wieder.
Auch Jules und seine Familie sind kurz nach ihrem Besuch nach Ruanda zurückgekehrt. Endgültig. Sie haben neue Arbeitsstellen und Freunde gefunden, Land erworben, ein Haus gebaut. Den Glauben ans Paradies hat Jules nicht verloren. Die grünen Hügel, das kupferne Licht und die rostrote Erde sind immer noch die Gleichen.
publiziert 10. April 2019, Wochenzeitung “Die Furche”